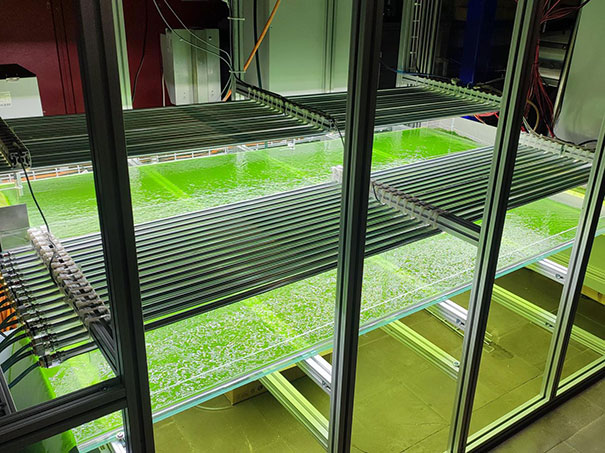Manche Menschen hören genauer hin. Zu diesen gehört Patricia Jäggi. In ihrer Dissertation befasste sie sich mit den Störgeräuschen im Schweizer Auslandradio von 1950 bis 1975. Sie untersuchte, wie diese die Wahrnehmung der Zuhörerinnen und Zuhörer beeinflussten. Jäggi fand heraus, dass sich unerwünschtes Rauschen oder ein übersteuertes Mikrofon durchaus positiv auswirken können, weil sie die Authentizität und Glaubwürdigkeit eines Berichts unterstreichen.
Heute ist Jäggi an der Hochschule Luzern als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds SNF finanzierten Projekts wird sie in den kommen vier Jahren mit einem Team untersuchen, wie Menschen Vogelstimmen wahrnehmen, und was das Gehörte in ihnen auslöst. Dabei will sie auch analysieren, ob und wie unterschiedliche Aufnahmetechniken das Hörempfinden der Menschen verändern.
«Vogelstimmen haben in der Musikgeschichte schon immer eine grosse Rolle gespielt – insbesondere in Kompositionen», erklärt Jäggi. Sie denkt dabei etwa an Olivier Messiaen, der nicht nur Komponist, sondern auch Ornithologe war. Auch DJs flechten in ihre Sets Vogelgesang ein. Laut der Expertin lässt sich seit den 1970er-Jahren ein weiteres Phänomen beobachten: «Die wachsende Besorgnis um Flora und Fauna widerspiegelt sich in den Künsten.»
Trompeten und quietschende Türen
Die Forschungsrichtung an der Schnittstelle zwischen Ökologie und Musik hat mittlerweile einen eigenen Namen: Ökomusikologie. In diesem Forschungsfeld hat Patrizia Jäggi ihre erste Vorstudie bereits abgeschlossen. Darin zeigte sie auf, wie die Erfindung des Phonographen, eines Geräts zur akustisch-mechanischen Aufnahme und Wiedergabe von Schall mithilfe von Tonwalzen, die bis dahin praktizierte Aufzeichnung von Vogelstimmen durch Lautmalerei oder grafische Musiknotation ablöste.
Im zweiten Teil der Vorstudie führte Jäggi Hörexperimente mit Studierenden durch, um herauszufinden, welche Vorstellungen diese mit Tierstimmen, etwa von Hyänen, Gibbons oder Mauerseglern, ab Tonband verbinden. Die Laute wurden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Bei den Hyänen glaubte eine grosse Mehrheit, es handle sich um Affen, die Gibbons hielten viele für Vögel; oft gingen die Assoziationen jedoch über das Tierreich hinaus. Die Teilnehmenden nannten die Rufe des Kranichs «trompetenartig» oder verglichen sie mit einem kaputten Fahrrad und quietschenden Türen.
Solchen Assoziationen möchte Jäggi mit ihrem Team und mit Unterstützung des Naturmuseums Luzern, der Vogelwarte Sempach und der Vogelschutzorganisation Birdlife auf den Grund gehen. Dabei werden auch Fachpersonen wie Ornithologen oder Klangkünstlerinnen interviewt. Diese sind in verschiedenen, aber gut vergleichbaren Weltgegenden beheimatet – Schweiz, Australien und Katalonien –, um allfälligen regionalen Unterschieden auf die Spur zu kommen. Weiter will das Forschungsteam beobachten, wie die Expertinnen und Experten im Feld agieren, welche Techniken sie für ihre Soundaufnahmen nutzen und was das für die Wahrnehmung der Vogelstimmen bedeutet. Jäggi: «Ich vermute, dass es einen Unterschied macht, ob jemand seine Umwelt durch Kopfhörer wahrnimmt oder ob man einfach dasitzt und lauscht.»
Einen Einblick in die Forschung gibt ab Herbst 2019 eine eigene Projekt-Website. Später ist auch eine begleitende Ausstellung im Naturmuseum Luzern geplant.
Kunstvolles Zwitschern: Viele Komponisten setzten Vogelstimmen in ihren Werken ein oder liessen sich von diesen zumindest inspirieren. Nachfolgend einige Beispiele: